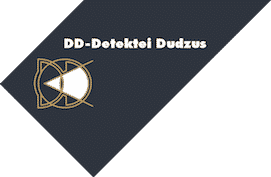Rechtsprechung unterliegt auch einem Wandel der Zeit. Wir haben Ihnen hier aktuelle Urteile zu den Themen Familienrecht, Arbeitsrecht und sonstiger Rechtsgebiete zusammengestellt. Ferner können Sie auch auf unsere Urteils-Archiv-Datenbank zugreifen und kostenfrei recherchieren.
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Mandanteninformationen. Wenn Sie recherchieren oder ältere Ausgaben betrachten möchten, können Sie hier unser Archiv aufrufen.
Zum Thema Arbeitsrecht
- Beweiswert erschüttert: Wer eine Online-AU ohne Arztkontakt nutzt, riskiert die fristlose Kündigung
- Halbgarer Arbeitsplatzwechsel: Dieselben Fähigkeiten an anderer Position erneut abzuverlangen, macht zweite Befristung hinfällig
- Kündigung trotz Betriebsübergangs? Neue Anschrift mit Bestandsmobiliar nicht zwangsläufig Zeichen für Fortführung des Betriebs
- Schwerer Vertrauensmissbrauch: Falsche Zeiterfassung im Öffentlichen Dienst zieht Kündigung nach sich
- Trotz hoheitlicher Aufgaben: Warum die Kündigung eines Konsulatschauffeurs vor deutschen Gerichten landete
Hätte der Angestellte in diesem Fall nicht an der falschen Stelle gegeizt, wäre ihm die Kündigung womöglich erspart geblieben. So aber musste sich das Landesarbeitsgericht Hamm (LAG) mit der Frage befassen, ob die online gekaufte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) in der Variante “ohne Arztgespräch” eine fristlose Kündigung rechtfertigen durfte. Das Gericht prüfte dabei auch, ob vorher eine Abmahnung nötig gewesen wäre.
Ein IT-Consultant, der seit 2018 im Unternehmen arbeitete, meldete sich für den Zeitraum vom 19. bis 23.08.2024 krank. Dafür nutzte er eine im Internet kostenpflichtig erstandene Bescheinigung, die der Anbieter in zwei Varianten anbot: einmal mit und einmal ohne Arztkontakt. Die Version “ohne Gespräch” war zwar günstiger, enthielt dafür aber auch einen umfangreichen Disclaimer, der Arbeitnehmern mit skeptischen Vorgesetzten die Premiumkrankschreibung empfahl. Doch es kam, wie es kommen musste: Der IT-Consultant entschied sich für die preiswertere der beiden Varianten. Das Dokument selbst sah nahezu aus wie der frühere Papiervordruck der Krankenkassen und enthielt persönliche Daten sowie den Vermerk “Erstbescheinigung”. Als Arztnummer stand dort lediglich “Privatarzt”. Die Firma versuchte später, die elektronische Meldung der Krankenkasse abzurufen, erhielt aber keine passende AU. Als die Personalabteilung erfuhr, dass die vorgelegte Bescheinigung möglicherweise nicht echt war, kündigte das Unternehmen dem Mann fristlos und vorsorglich ordentlich.
Das Arbeitsgericht hielt diese Kündigung zunächst für unwirksam, doch das LAG kam zu einem anderen Ergebnis und sah einen wichtigen Grund für eine sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Nach seiner Auffassung täuschte der Beschäftigte bewusst vor, seine Arbeitsunfähigkeit sei nach einem ärztlichen Kontakt bestätigt worden. Damit verletzte er seine Pflicht zur Rücksichtnahme und zerstörte das notwendige Vertrauen. Ob er tatsächlich arbeitsunfähig gewesen war, spielte dabei keine Rolle. Die Form der Bescheinigung konnte leicht den Eindruck erwecken, sie würde auf einem medizinischen Kontakt beruhen. Dem Beschäftigten selbst war klar, dass kein Arztgespräch stattgefunden hatte, und auch der Online-Anbieter machte deutlich, dass das Dokument nicht nach regulären medizinischen Standards erstellt worden sei. Das LAG sah deshalb den Beweiswert der Bescheinigung als erschüttert. Angesichts der Täuschung musste der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht bis zum Ende einer Kündigungsfrist fortsetzen. Eine Abmahnung war nach Einschätzung des Gerichts in diesem Fall nicht erforderlich, weil der Vertrauensbruch zu schwer wog.
Hinweis: Online-AUs ohne Arztkontakt bergen das Risiko, als Täuschung gewertet zu werden. Wer eine solche Bescheinigung nutzt, riskiert die fristlose Kündigung. Entscheidend ist, dass für den Arbeitgeber ein falscher Eindruck entsteht.
Quelle: LAG Hamm, Urt. v. 05.09.2025 – 14 SLa 145/25
| zum Thema: | Arbeitsrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Nach Ansicht seiner Arbeitgeberin hatte ein Mitarbeiter in diesem Fall lediglich intern die Abteilungen gewechselt. Doch so schlüssig waren die Umstände nicht, die vor das Arbeitsgericht Köln (ArbG) führten. Weil der Mitarbeiter im Kinobetrieb gleich zweimal hintereinander befristet eingestellt und dann entlassen wurde, war nun zu prüfen, ob die zweite befristete Anstellung ohne Sachgrund überhaupt gültig war und somit auch die darauffolgende Kündigung.
Das Filmtheater stellte einen Beschäftigten zunächst von Ende August 2023 bis Ende August 2024 als Filmvorführer in Teilzeit ein. Zu seinen Aufgaben gehörten auch Moderationen und Vorbereitungen eines besonderen Filmformats. Fünf Tage nach Ablauf dieses Vertrags erhielt er einen neuen befristeten Vertrag als Teilzeitkraft im Marketing, ebenfalls für ein Jahr. Während dieser Zeit übernahm er gelegentlich wieder die vorherige Tätigkeit als Filmvorführer und Tätigkeiten im Service. Im April 2025 folgte schließlich eine fristlose Kündigung, die jedoch nur von einer von zwei Geschäftsführerinnen unterzeichnet war, obwohl laut Handelsregister beide gemeinsam zeichnen mussten. Der Beschäftigte wies die Kündigung daher zurück und machte geltend, dass die erneute Befristung sowieso unwirksam gewesen sei.
Das ArbG bestätigte zunächst, dass die fristlose Kündigung schon wegen der fehlenden Vollmacht nicht gültig war. Anschließend bewertete es die Befristung des zweiten Vertrags. Nach dem Gesetz ist eine Befristung ohne Grund nur dann zulässig, wenn vorher kein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber bestanden hat. Da der Beschäftigte bereits ein Jahr zuvor dort gearbeitet hatte, durfte der neue Vertrag nicht erneut ohne Sachgrund befristet werden. Die kurze Unterbrechung von wenigen Tagen änderte daran nichts. Auch die Aufgaben im Marketing unterschieden sich nach Ansicht des Gerichts nicht so deutlich von der früheren Tätigkeit, dass eine Ausnahme erlaubt gewesen wäre. Beide Stellen waren Teilzeitjobs und verlangten ähnliche Fähigkeiten. Damit galt die Befristung als unwirksam – das Arbeitsverhältnis lief unbefristet weiter.
Hinweis: Eine sachgrundlose Befristung ist nach einer Vorbeschäftigung beim selben Arbeitgeber grundsätzlich ausgeschlossen. Nur wenn die neue Tätigkeit völlig andere Qualifikationen verlangt, kann es Ausnahmen geben.
Quelle: ArbG Köln, Urt. v. 09.10.2025 – 12 Ca 2975/25
| zum Thema: | Arbeitsrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Eine neue Adresse unter selbem Namen, in die auch das bestehende Mobiliar gebracht wird, deutet augenscheinlich auf einen völlig üblichen Umzug hin. Doch heißt das bei einem Unternehmen automatisch auch, dass es willens ist, dort seinen Betrieb fortzuführen, obwohl es sich inmitten eines Insolvenzverfahrens befindet? Das Arbeitsgericht Herford (ArbG) prüfte nach, ob eine frische Adresse oder gar die Nutzung einer Marke zwangsläufig für eine Weitergabe des Betriebs spricht.
Im Unternehmen arbeitete seit langer Zeit eine Beschäftigte in der Auftragsbearbeitung, die zudem den Betriebsrat führte. Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 31.03.2025 legten Leitung und Betriebsrat sofort fest, dass der Betrieb abgewickelt werden solle. Noch am selben Tag gingen mehrere Kündigungen heraus. Im Mai 2025 verschärfte sich die finanzielle Lage weiter, so dass Firma und Betriebsrat schriftlich beschlossen, die gesamte Produktion endgültig zu beenden. Die Beschäftigte gehörte zu 64 Betroffenen. Am 28.05.2025 kündigte das Unternehmen das Arbeitsverhältnis fristgerecht zum 31.08.2025. Die Beschäftigte meinte jedoch, der Betrieb sei nicht wirklich stillgelegt worden, und verwies auf eine neu genutzte Anschrift, einen Presseartikel zur Fortführung der Marke sowie das Abholen einzelner Möbelstücke. Für sie deutete dies darauf hin, dass die Tätigkeit an anderer Stelle weiterging.
Das ArbG sah das jedoch anders und hielt die Kündigung durchaus für zulässig. Nach seiner Einschätzung stand bereits lange vor der Kündigung fest, dass die Firma ihre Arbeit komplett einstellen werde. Zudem bestätigte ein unterschriebener Interessenausgleich, dass keine Produktion mehr stattfinden werde und lediglich noch die Abwicklung laufe. Die Räume waren bereits vollständig geleert, und da diese Angaben nicht bestritten wurden, galten sie als sicher. Ebenfalls stellte das Gericht klar, dass für einen Übergang an einer neuen Stelle eine wirtschaftliche Einheit im Kern bestehen bleiben müsse – und genau davon konnte hier keine Rede sein: Denn weder gingen zentrale Maschinen noch wesentliche Arbeitsbereiche oder größere Teile der Belegschaft über. Das Mitnehmen einzelner Dekorationsstücke oder Möbel spiele dabei keine Rolle. Die spätere Nutzung der Marke an einem anderen Ort reiche ebenfalls nicht aus. Die neue Anschrift erklärte sich laut Firma allein durch den auslaufenden Mietvertrag.
Hinweis: Ein Betriebsübergang setzt mehr voraus als neue Räume oder Markenrechte. Entscheidend ist, dass ein Betrieb im Kern weitergeführt wird. Ohne diesen Kern bleibt eine betriebsbedingte Kündigung möglich.
Quelle: ArbG Herford, Urt. v. 02.10.2025 – 3 Ca 418/25
| zum Thema: | Arbeitsrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Hier und da mal etwas mehr, das kann doch nicht so schlimm sein – oder? Was in der Küche möglich ist, sollte in Sachen Arbeitszeiterfassung tunlichst unterlassen werden. Ist eine bewusste Täuschung nachweisbar, so wie im Fall des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-Vorpommern (LAG), können falsch eingetragene Arbeitszeiten eine Kündigung rechtfertigen. In seinem Urteil legte das Gericht dar, welche Folgen ein bewusster Umgang mit unrichtigen Zeitangaben hat.
Eine Verwaltungsmitarbeiterin stand seit Anfang 2021 in einem Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst. An einem Oktobermorgen im Jahr 2023 begab sie sich direkt von zuhause aus zu einem Termin in einem Ministerium. Der Weg dorthin war kurz und zu Fuß gut erreichbar. Laut Eintragungen im Wachbuch hielt sie sich dort etwas mehr als anderthalb Stunden auf. Danach ging sie zu ihrer Dienststelle und meldete sich erst gegen zehn Uhr im elektronischen Zeitsystem an. Kurz danach beantragte sie eine rückwirkende Änderung der Arbeitszeit, und zwar einen deutlich früheren Beginn des Arbeitstags. Der Dienstbeginn lag vor den Eintragungen im Wachbuch des Ministeriums. Zudem trug sie ab diesem Zeitpunkt eine Dienstreise wegen eines angeblichen Termins ein. Zunächst wurden diese Angaben auch akzeptiert. Wenige Tage später fragte die Führungskraft jedoch nach, welche Aufgaben in dieser Zeit erledigt worden seien. Daraufhin bat die Mitarbeiterin erneut um eine Änderung und erklärte, sich bei der Uhrzeit vertan zu haben. Die Arbeitgeberin sah darin jedoch keinen Irrtum, sondern eine bewusste Täuschung; sie sprach der Verwaltungsmitarbeiterin die ordentliche Kündigung aus.
Das LAG bestätigte diese Entscheidung. Nach Ansicht des Gerichts waren die Zeitangaben absichtlich falsch gemacht worden, um eine längere Arbeitszeit vorzutäuschen. Ein solches Verhalten verletzte die Pflicht zur korrekten Zeiterfassung schwer. Dabei spielte es keine Rolle, welches System zur Erfassung genutzt wurde. Entscheidend war allein das bewusste Täuschen. Eine vorherige Abmahnung hielt das LAG hier nicht für nötig, da das Vertrauen nachhaltig zerstört gewesen sei. Auch eine Weiterbeschäftigung bis zum Ende der Kündigungsfrist erschien dem Gericht unzumutbar.
Hinweis: Arbeitszeiten müssen korrekt und ehrlich erfasst werden. Absichtliche Falschangaben können den Arbeitsplatz kosten. Vertrauen gilt als zentrale Grundlage jedes Arbeitsverhältnisses.
Quelle: LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urt. v. 09.09.2025 – 5 SLa 9/25
| zum Thema: | Arbeitsrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Allgemeinhin genießen Konsulatsmitarbeiter diverse Immunitäten und Privilegien, unter anderem auch die Befreiung von der Gerichtsbarkeit. Warum die Kündigung eines solchen Konsulatsangestellten überhaupt vor deutschen Gerichten verhandelt werden konnte, zeigt das Hessische Landesarbeitsgericht (LAG) auf. Außerdem prüfte es auch, ob die Beendigung des Arbeitsverhältnisses inhaltlich gerechtfertigt war.
Ein langjährig Angestellter eines Generalkonsulats arbeitete dort seit 1980 und war ab 1995 als Chauffeur für die Konsulatsleitung tätig. Neben den Fahrten erledigte er kleinere Aufgaben im Gebäude, etwa Botengänge oder Arbeiten im Archiv. Die Anweisungen für den Alltag kamen unmittelbar von der Generalkonsulin oder dem Generalkonsul. Im März 2022 erlitt der Beschäftigte einen Unfall und fiel für längere Zeit aus. Nach der Behandlung stellte die Klinik fest, dass er künftig nicht mehr fahren könne, ihm andere leichte Tätigkeiten aber möglich seien. Am 19.09.2022 ging ihm ein Schreiben des Konsulats zu, das sein Arbeitsverhältnis zum 30.04.2023 enden lassen sollte. Die Begründung lautete, dass seine Hauptaufgabe künftig wegfiele und es im Konsulat keinen passenden Ersatzplatz gäbe. Der Beschäftigte hielt die Beendigung inhaltlich für fehlerhaft und führte an, dass nicht eindeutig feststehe, wer die Kündigung unterschreiben dürfe, und er weiterhin Aufgaben im Haus übernehmen könne.
Die Kündigungsschutzklage wies zuerst das zuständige Arbeitsgericht (ArbG) in Frankfurt am Main ab. Zur Frage, ob deutsche Gerichte hierfür überhaupt zuständig seien, war das ArbG der Ansicht, dass sich das Land mangels hoheitlicher Tätigkeiten des Chauffeurs nicht habe auf die Staatenimmunität berufen können. Die Kündigung selbst hielt das ArbG für sozial gerechtfertigt und somit für wirksam. Dagegen wehrte sich der Entlassene.
Doch auch das LAG blieb im Generellen bei der Sichtweise der Vorinstanz. Zwar widersprach es den Kollegen dahingehend, dass der Mann durchaus hoheitliche Tätigkeiten ausgeführt hatte und sich seine Arbeitgeberin somit auch auf die Staatenimmunität hätte berufen können. Dass der Fall dennoch in die deutsche Gerichtsbarkeit fiel, war schlicht und einfach der Tatsache geschuldet, dass das Konsulat am Verfahren teilnahm, ohne sich auf Staatenimmunität zu berufen. Dadurch galt dieser Schutz als aufgegeben. Inhaltlich half das dem Gekündigten jedoch nicht. Denn auch das LAG stellte fest, dass der Mann dauerhaft nicht mehr als Fahrer arbeiten konnte und damit ein personenbedingter Grund vorlag, ihm zu kündigen. Für eine Weiterbeschäftigung hätte ein freier, sinnvoller Arbeitsplatz bestehen müssen. Da es eine solche Stelle jedoch nicht gab und der betreffende Staat keinen neuen Arbeitsplatz einrichten musste, blieb die Kündigung wirksam.
Hinweis: Eine Staatenimmunität entfiel hier deshalb, weil das Konsulat sich ohne Einwand auf das Verfahren einließ. Für eine Weiterbeschäftigung reicht es hingegen nicht aus, dass früher einzelne Nebenaufgaben übernommen wurden. Entscheidend ist, ob ein geeigneter freier Arbeitsplatz vorhanden war.
Quelle: Hessisches LAG, Urt. v. 01.08.2025 – 10 SLa 86/25
| zum Thema: | Arbeitsrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Zum Thema Familienrecht
- Aufwandspauschale statt Betreuervergütung: Wer als Berufsbetreuer die Registrierung gemäß BtOG ignoriert, muss starke Einbußen in Kauf nehmen
- Namensrecht und Persönlichkeitsrecht: Tochter darf Geburtsnamen der verstorbenen Mutter annehmen, den diese nach der Scheidung wieder trug
- Namensungleichheit durch Patchwork: Den Namen des Stiefvaters als neuen Familiennamen anzunehmen, dient dem Kindeswohl
- Tatsachengrundlage beim Sorgerecht: Ausländische Sorgerechtsentscheidung kann auch ohne Anhörung des Kindes anerkannt werden
- Trennungsjahr und Unzumutbarkeit: Wer sich auf die Härtefallregelung stützen will, sollte unmittelbar handeln
Wurde eine natürliche Person vor dem 01.01.2023 als Berufsbetreuer bestellt, musste sie sich ab dem 01.07.2023 nach dem Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) registrieren lassen. Tat sie dies nicht, setzte aber die Betreuung trotzdem über diesen Stichtag hinaus fort, war sie “nur” noch ehrenamtlicher Betreuer. Zu welchen Problemen das führen kann, zeigt dieser Fall vor dem Bundesgerichtshof (BGH).
Ein Betreuer wurde vor dem 01.01.2023 als Berufsbetreuer eingesetzt. Schon im Juni 2023 hatte er aus Altersgründen einen Betreuerwechsel angeregt, wurde aber erst im August 2023 aus seinem Amt entlassen. Er hat also seine Betreuungsleistung über den 30.06.2023 hinaus fortgeführt, ohne sich nach dem BtOG registriert zu haben. Als er nach seiner Entlassung seine Betreuervergütung abrechnen wollte, wurde ihm diese nur bis zum 30.06.2023 gewährt. Vom 01.07. bis zum 24.08.2023 erhielt er indes nur eine Aufwandspauschale. Er legte Rechtsbeschwerde bis zum BGH ein – leider ohne Erfolg.
Der BGH war hier bezüglich einer anderen Bewertung schlichtweg machtlos, da seit dem 01.01.2023 für die vergütungsrechtliche Einordnung nicht mehr die gerichtliche Feststellung der Berufsmäßigkeit, sondern allein jene nach dem BtOG gilt. Der Betreuer hatte keinen Registrierungsantrag gestellt, womit er ab dem 01.07.2023 nur noch als ehrenamtlicher Betreuer galt. Ein ehrenamtlicher Betreuer hat jedoch keinen Anspruch auf Vergütung und kann lediglich eine Aufwandspauschale verlangen. Diese konnte auch ohne ausdrücklichen Antrag festgesetzt werden.
Hinweis: Gerade im Betreuungsrecht kommt es häufiger zu Änderungen. Als Betreuer sollten Sie diese immer beachten, da Sie sonst Nachteile erfahren können – wie der Betreuer im Fall, der einen finanziellen Nachteil erlitt.
Quelle: BGH, Urt. v. 22.10.2025 – XII ZB 80/25
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Möchte ein volljähriges Kind seinen Geburtsnamen neu bestimmen lassen, benötigt es hierzu die Einwilligung des Elternteils, dessen Namensänderung es sich anschließen möchte. Was aber passiert, wenn diese Einwilligung gar nicht mehr erteilt werden kann, zeigt dieser Fall des Amtsgerichts Köln (AG).
Eine Frau wollte den Geburtsnamen ihrer im Jahr 2012 verstorbenen Mutter annehmen. Seit Geburt trug die Frau zwar den Ehenamen ihrer Eltern als Geburtsnamen, nach der Scheidung hatte die Mutter jedoch ihren Geburtsnamen wieder angenommen. Und eben diesen wollte die Tochter nun auch annehmen. Das Standesamt bezweifelte jedoch, ob dies ohne Einverständniserklärung der toten Mutter überhaupt möglich ist.
Das AG konnte diese Unsicherheit nun ausräumen: Die Tochter darf ihren Namen wunschgemäß ändern lassen. Das volljährige Kind kann sich einer Namensänderung eines geschiedenen oder verwitweten Elternteils durch eigene Erklärung gegenüber dem Standesamt anschließen. Die Möglichkeit der Neubestimmung des Geburtsnamens ist dabei an keine Frist gebunden. Zwar kann die Neubestimmung des Geburtsnamens nur mit Einwilligung des Elternteils, dessen Namensänderung das volljährige Kind folgt, durchgeführt werden. Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts dieses Elternteils soll ihm das Kind schließlich nicht gegen seinen eigenen Willen namentlich zugeordnet werden. Ist der Elternteil – wie hier – hingegen bereits verstorben, kann sich das volljährige Kind auch ohne diese Einwilligung anschließen. Die Namensrechte des verstorbenen Elternteils spielen dann nämlich keine Rolle mehr.
Hinweis: Keine Regel ohne Ausnahme! Es ist schlicht auch nicht erkennbar, welchen Schaden die tote Mutter davon hätte, dass ihre Tochter ihren Namen annimmt. Grundsätzlich ist es in der Rechtsprechung die Regel, dass die Namensrechte von Verstorbenen weitaus weniger Beachtung finden als deren Rechte zu Lebzeiten.
Quelle: AG Köln, Beschl. v. 28.11.2025 – 378 III 98/25
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Seit dem 01.05.2025 gilt in Deutschland ein neues Namensrecht. Dieses gibt Betroffenen nicht nur mehr Freiheit bei Doppelnamen für Ehepaare und Kinder; es erleichtert zudem Stief- und Scheidungskindern die Namensänderung. Wenn es dem Kindeswohl diene, sollten diese Erleichterungen dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) zufolge auch in Altfällen gelten, also in Fällen aus der Zeit vor dem 01.05.2025. Der von dem OLG hierzu entschiedene Fall zeigt klar auf, warum.
Die Eltern eines Mädchens hatten sich bereits vor dessen Geburt getrennt. Als Familiennamen erhielt das Kind die Geburtsnamen der Mutter und des portugiesischen Vaters. Von Geburt an hatte nur die Mutter das alleinige Sorgerecht. Kontakt zum Vater gab es nur sehr selten, gegen ihn wurden dafür aber häufig Gewaltschutzanordnungen erlassen. Dann lernte die Mutter einen neuen Mann kennen und heiratete ihn. Aus dieser Beziehung ging ein Sohn hervor. Nun wollte die Mutter, dass auch die Tochter den Namen des neuen Ehemanns annimmt, der leibliche Vater aber stimmte diesem Wunsch nicht zu. Deswegen beantragte die Mutter, die Einwilligung des Vaters in die sogenannte “Einbenennung” gerichtlich ersetzen zu lassen.
Das OLG hörte die Eltern des Kindes an und holte zudem ein Sachverständigengutachten zu den Auswirkungen der Namensungleichheit ein. Die Zustimmung des leiblichen Vaters wurde schließlich ersetzt. Die Mutter konnte sich mit ihrem Wunsch nach der Namensänderung also durchsetzen. Zwar hatte die Mutter den Antrag auf Ersetzung der Zustimmung des Vaters gestellt, als die alte strengere Rechtslage noch galt. Trotzdem konnte das Gericht hier nach der neuen Rechtslage entscheiden, weil das dem Kindeswohl diente. Es verstieß dabei auch nicht gegen das Rückwirkungsverbot, da die Namensänderung schließlich nur für die Zukunft gilt.
Hinweis: Auch bei Altfällen können Sie sich also auf die aktuellen Namensregelungen berufen, sobald dies dem Wohl Ihres Kindes dient. Dies ist auch nachvollziehbar, denn erst dadurch, dass das Mädchen in diesem Fall den gleichen Namen trägt wie Mutter, Stiefvater und Halbbruder, wird auch nach außen gezeigt, dass es sich um eine Familie handelt. Das Mädchen mag aus einer früheren Beziehung stammen, gehört aber jetzt auch zur neuen Familie dazu.
Quelle: OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 28.11.2025 – 2 WF 115/25
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Die Welt ist mobil, und innerhalb der EU herrscht Freizügigkeit. Das führt wiederum auch dazu, dass Menschen mitsamt ihrer Geschichte umziehen, also auch mit ausländischen Sorgerechtstiteln, die dann in Deutschland anerkannt werden müssen. Ein solcher Fall schaffte es vor kurzem bis vor den Bundesgerichtshof (BGH).
Die Eltern eines im Februar 2015 geborenen Kindes lebten in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Als die Eltern sich scheiden ließen, erließ das dortige Amtsgericht einen Beschluss, mit dem die Scheidung der Ehe ausgesprochen und die elterliche Sorge für das Kind dem Vater übertragen wurde. Umgangskontakte zwischen der Mutter und dem Kind wurden aber festgelegt. Kurze Zeit nach dieser Entscheidung verließ die Mutter mit dem Kind Bulgarien und zog nach Berlin. Der Vater erhielt eine “Vollstreckbare Ausfertigung” der Sorgerechtsentscheidung, die die Anordnung enthält, dass die Kindesmutter das betroffene Kind unverzüglich an den Kindesvater herauszugeben habe. Diese Sorgerechtsentscheidung wurde in Deutschland anerkannt. Die Mutter legte Beschwerde ein, da man hierzu das Kind nicht angehört hatte.
Der BGH gab hingegen dem Vater Recht. Denn nach Europarecht werden die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen grundsätzlich in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt, ohne dass es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf. Eine explizite Entscheidung über die Anerkennung kann aber auch beantragt werden, wenn eine Partei hieran ein Interesse hat, wie eben der Kindsvater am Sorgerecht für sein Kind. Die mangelnde Anhörung des Kindes kann durchaus ein Anerkennungshindernis sein. Hier jedoch hatte das bulgarische Gericht eine ausreichende Tatsachengrundlage für seine Entscheidung, auch wenn es das Kind nicht angehört hatte.
Hinweis: Kinder sollen grundsätzlich angehört werden, wenn Entscheidungen ergehen, die sie betreffen. Davon kann aber abgesehen werden, wenn eine Anhörung tatsächlich unmöglich ist. Dies kann der Fall sein, wenn der Aufenthaltsort des Kindes unbekannt ist oder wenn das Gericht auch ohne Anhörung ausreichend Material hat, um sachgerecht zu entscheiden. Letzteres war hier anscheinend auch der Fall.
Quelle: BGH, Beschl. v. 03.12.2025 – XII ZB 169/25
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Möchten sich Eheleute scheiden lassen, müssen sie ein Trennungsjahr einhalten. Nur in besonderen Fällen kann eine Härtefallscheidung dieses Jahr hinfällig machen und eine sofortige Scheidung ermöglichen. Dazu muss die Fortführung der Ehe für den einen Ehegatten aber nachweislich unzumutbar sein. Ob dies im Folgenden der Fall war, musste das Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG) prüfen und bewerten.
Der Vater war mutmaßlich betrunken nach Hause gekommen und soll die gemeinsame, damals sechsjährige Tochter im Intimbereich angefasst haben. Zudem verlangte er von ihr, ihn unsittlich zu berühren – wohl nicht der erste Vorfall dieser Art. Auch eine Freundin der Mutter soll der Mann unerwünscht angefasst haben. Zudem hatte er seiner Ehefrau bereits das Nasenbein gebrochen. Kurz nach dem Vorfall mit dem Kind zog der Mann schließlich aus. Rein formal begann das Trennungsjahr somit am 18.01.2025. Ende Januar 2025 beantragte die Mutter vor Gericht die Härtefallscheidung. Damit kam sie aber nicht durch.
Das OLG begründete die Ablehnung der Härtefallscheidung wie folgt: Der Bruch des Nasenbeins konnte keine unzumutbare Härte mehr begründen, da sich dieser Vorfall bereits vor 15 Jahren ereignet hatte. Das sei für eine jetzige Härte schlichtweg zu lange her, zudem hatten sich die Eheleute im Anschluss auch wieder versöhnt. Da sich die Frau nach dem Vorfall mit ihrer Freundin ebenfalls nicht von ihrem Mann getrennt hatte, hat sie auch diesen Übergriff offenbar toleriert. Weitere Übergriffe konnten nicht überzeugend geschildert werden. Anders verhielt es beim sexuellen Übergriff auf die gemeinsame Tochter – diesen hatte der Ehemann in einer SMS an seine Frau quasi selbst eingeräumt. Aus diesem Übergriff, der ja auch strafbar ist, kann aber auch kein Härtefall konstruiert werden. Die Ehe sei “nur” gescheitert. Zudem war es hier so, dass die Eheleute sich getrennt hatten und kein Kontakt zwischen Vater und Tochter mehr bestand. Deswegen sei es der Mutter zumutbar, die restlichen zwei Monate des Trennungsjahres noch auszuhalten.
Hinweis: Wenn Sie sich auf einen Härtefall stützen wollen, sollten Sie stets unmittelbar agieren. Je länger ein Verhalten Ihrerseits folgenlos bleibt und damit augenscheinlich toleriert wird, desto schlechter können Sie die Unzumutbarkeit für sich behaupten. Außerdem spielt es bei der gerichtlichen Entscheidung auch eine Rolle, wie viel Zeit des Trennungsjahres noch vor Ihnen liegt. Im Fall waren die “letzten zwei Monate” für die Frau auszuhalten, vielleicht aber hätte das Gericht anders geurteilt, wenn es noch sechs oder sieben Monate gewesen wären. Je schneller Sie also handeln, desto mehr “Härtefaktoren” können Sie für sich anführen und damit Ihre Erfolgschancen verbessern.
Quelle: OLG Karlsruhe, Beschl. v. 26.12.2025 – 5 UF 151/24
| zum Thema: | Familienrecht |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Zum Thema Sonstiges
- Alles Zumutbare getan? Nicht jede Verspätung durch Blitzeinschlag zieht Anspruch auf Ausgleichszahlung nach sich
- Hündin entkommt Flugfracht: Haustiere sind bei Verlust als Reisegepäck zu werten und auf Höchstbetrag begrenzt
- Pauschalhinweis zu Corona: Ohne konkrete vertragliche Nennung der Krankheit greift Betriebsschließungsversicherung nicht
- Trotz Haftungsausschluss: Hauskauf nach arglistiger Täuschung anfechtbar
- Trotz fehlender Zulassung: Kein Rückerstattungsanspruch nach bereits in Anspruch genommenem Coaching
Das Leben ist oft unberechenbar – selbst, wenn wir alles daransetzen, es absehbarer zu gestalten. Auch Fluggesellschaften sind angehalten, alles ihnen Mögliche zu tun, um ihren Flugverkehr so zuverlässig wie möglich durchzuführen. Sonst kann es teuer werden. Was aber ihre Pflicht zur Zahlung einer Entschädigung nach einem Blitzeinschlag und den daraufhin notwendigen Maßnahmen angeht, musste kürzlich der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheiden.
Bei dem Vorfall wurde ein Flugzeug der Austrian Airlines kurz vor der Landung in Rumänien von einem Blitz getroffen. Dadurch mussten obligatorische Sicherheitskontrollen durchgeführt werden, die den nachfolgenden Flug nach Wien verspätet starten ließen. Ein Passagier kam mit einem Ersatzflug mehr als sieben Stunden später in Wien an und forderte deshalb eine Ausgleichszahlung von 400 EUR von der Fluggesellschaft. Die Airline argumentierte, dass der Blitzeinschlag und die erforderlichen Sicherheitsprüfungen einen außergewöhnlichen Umstand darstellten und sie selbst alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen hatte, um die Verspätung zu begrenzen. Das zuständige österreichische Gericht legte den Fall dem EuGH zur Vorabentscheidung vor.
Der EuGH stellte klar, dass ein Blitzeinschlag, der zwingende Sicherheitskontrollen nach sich zieht, einen außergewöhnlichen Umstand darstellt, die das Flugzeug am planmäßigen Einsatz hindern. Derartige Ereignisse gehören nicht zum normalen Betrieb einer Fluggesellschaft und sind deshalb von ihr auch nicht beherrschbar. Durch die darauffolgenden Maßnahmen soll garantiert werden, dass die Sicherheit der Fluggäste immer Vorrang vor Pünktlichkeit hat. Die Fluggesellschaft kann sich genau dann von der Zahlung einer Entschädigung befreien, wenn sie nachweisen kann, dass sie alles Zumutbare unternommen hat, um die Verspätung oder deren Folgen zu vermeiden. Ob dies im konkreten Fall geschehen ist, muss nun das österreichische Gericht prüfen.
Hinweis: Ein Blitzeinschlag kann eine Fluggesellschaft von der Entschädigungspflicht befreien. Entscheidend ist, dass das Unternehmen alle möglichen Maßnahmen ergriffen hat, um Verspätungen zu verhindern. Letztlich entscheidet das zuständige nationale Gericht über die Anwendung dieser Grundsätze.
Quelle: EuGH, Urt. v. 16.10.2025 – C‑399/24
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Zuerst einmal klingt es logisch: Wird etwas im Gepäck- bzw. Frachtraum eines Flugzeugs transportiert, muss es sich folglich auch um Gepäck handeln. Der hier behandelte Verlust war dann doch etwas tragischer als ein verlorener Koffer: Hier war der Verlust eines Hunds zu beklagen. Was daraus folgt, musste – wie oft bei Rechtsfragen im Flugverkehr – der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheiden.
Eine Frau flog im Oktober 2019 mit ihrer Mutter und ihrer Hündin von Buenos Aires nach Barcelona. Die Hündin musste wegen ihrer Größe jedoch in einer Transportbox im Frachtraum befördert werden. Die Vierbeinerin war mit dieser Entscheidung offenbar nicht einverstanden, denn dem Tier gelang es, während der Beförderung der Box zu entkommen. Sie wieder einzufangen, gelang hingegen leider nicht. Das Frauchen forderte daraufhin eine Entschädigung von 5.000 EUR, da sie den Verlust ihrer Hündin als immateriellen Schaden ansah. Die Fluggesellschaft Iberia erkannte zwar ihre Verantwortung durchaus an, zahlte aber nur den im Übereinkommen von Montréal für aufgegebenes Gepäck vorgesehenen Höchstbetrag. Die spanischen Gerichte legten den Fall dem EuGH vor, um klären zu lassen, ob Haustiere als Reisegepäck gelten.
Der EuGH stellte schließlich klar, dass Haustiere durchaus unter den Begriff “Reisegepäck” fallen. Zwar versteht man üblicherweise unter Gepäck Gegenstände, doch das Übereinkommen von Montréal schließt Tiere hierbei nicht aus. Für den Ersatz gilt daher der festgelegte Höchstbetrag von derzeit knapp unter 2.000 EUR, sofern beim Check-in kein höherer Wert angegeben wurde. Wer diesen Betrag für zu niedrig hält, kann bei Zustimmung der Fluggesellschaft einen höheren Wert festlegen und den entsprechenden Aufpreis zahlen. Dass der Tierschutz ein wichtiges Ziel der Union ist, schließt nicht aus, dass Tiere bei der Beförderung rechtlich als Gepäck behandelt werden, solange während des Transports auf ihr Wohlergehen geachtet wird.
Hinweis: Haustiere werden bei Flugreisen wie aufgegebenes Gepäck behandelt. Wer den maximalen Haftungsbetrag erhöhen möchte, muss diesen vor Abflug angeben und den Zuschlag zahlen. Die Fluggesellschaft haftet für einen Verlust nur bis zur Höhe des angegebenen oder des gesetzlich festgelegten Betrags. Doch den finanziellen Aspekt mal völlig außen vor gelassen: Da Geld den vierbeinigen Begleiter in den meisten Fällen nicht zu ersetzen vermag, versuchen Sie möglichst, Ihrem Tier diese Tortur im Frachtraum zu ersparen.
Quelle: EuGH, Urt. v. 16.10.2025 – C‑218/24
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) musste bewerten, ob eine abgeschlossene Betriebsschließungsversicherung Schutz für coronabedingte Schließungen bietet, obwohl COVID-19 nicht ausdrücklich im Versicherungsvertrag genannt wurde. Ob pauschale Hinweise des Versicherers auf der Website, dass das Corona-Virus “im Rahmen der Bedingungen” versichert sei, auf diese Bewertung Einfluss nahmen, lesen Sie hier.
Ein Freizeitstättenbetrieb hatte seit 2005 eine Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen. Anfang März 2020 wurde der Vertrag durch einen Nachtrag angepasst, die Tagesentschädigung erhöht und ein Katalog meldepflichtiger Krankheiten tabellarisch aufgelistet – COVID-19 war dort noch nicht enthalten. Mitte März 2020 veröffentlichte der Versicherer auf seiner Website, dass Schäden durch das Corona-Virus “im Rahmen der Bedingungen” mitversichert seien. Ab dem 18.03.2020 musste der Betrieb aufgrund einer behördlichen Anordnung schließen. Ein Schaden von 120.000 EUR wurde gemeldet, der Versicherer lehnte die Zahlung ab.
Sowohl das zuvor mit der Sache betraute Landgericht als auch das OLG bestätigten die Ablehnung. Das OLG begründete die Entscheidung damit, dass der Vertrag nur für die ausdrücklich aufgeführten Krankheiten Versicherungsschutz bot. Die Formulierung auf der Website “im Rahmen unserer Bedingungen” machte deutlich, dass nur Leistungen nach den vertraglich vereinbarten Bedingungen erbracht werden sollten. COVID-19 war in diesen Bedingungen nicht enthalten, so dass weder eine Pflichtverletzung noch ein treuwidriges Verhalten des Versicherers vorlag. Frühere Urteile des Bundesgerichtshofs bestätigten, dass ein pauschaler Hinweis auf Versicherungsdeckung ohne konkrete Nennung der Krankheit den Vertrag nicht erweitert. Auch für den zweiten Lockdown ergaben sich keine anderen Regelungen, da die Bedingungen des Vertrags vergleichbar waren.
Hinweis: Betriebsschließungsversicherungen decken nur die im Vertrag namentlich genannten Krankheiten ab. Hinweise auf Internetseiten ändern den Umfang des Versicherungsschutzes nicht. Wer Schutz für neue Krankheiten will, muss dies ausdrücklich im Vertrag vereinbaren.
Quelle: OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 16.06.2025 – 12 U 145/24
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Ob ein Hauskauf auch dann rückgängig gemacht werden kann, wenn zwar ein Gewährleistungsausschluss vereinbart wurde, der Verkäufer den tatsächlichen Zustand des Hauses aber verschwiegen hat, musste das Landgericht Frankenthal (LG) kürzlich beantworten. Ob der alte Spruch “Wer schreibt, der bleibt” beim vertraglichen Haftungsausschluss Verkäufer also schützt, obwohl diese ihre Kunden absichtlich getäuscht haben, lesen Sie hier.
Eine Käuferin erwarb ein Haus in Neustadt an der Weinstraße für über 600.000 EUR unter Ausschluss der Gewährleistung. Im Expose des Maklers wurde das Haus als “liebevoll kernsaniert” angepriesen. Die Verkäuferin verschwieg jedoch ein wichtiges Detail: Einige Monate zuvor hatte sie erfahren, dass für die Außentreppe und die Terrasse keine Baugenehmigungen bestanden. Nach dem Kauf forderte die Stadtverwaltung die Käuferin daher auch auf, die baulichen Anlagen zu entfernen. Zusätzlich stellte ein von der Käuferin beauftragter Elektriker fest, dass die Elektroinstallation nicht neuwertig war, sondern noch aus den 1990er Jahren stammte. Die Käuferin erklärte daraufhin die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung und trat hilfsweise vom Vertrag zurück. Die Verkäuferin berief sich jedoch auf den vereinbarten Gewährleistungsausschluss.
Das LG gab der Käuferin dennoch Recht. Der Kaufvertrag konnte wegen arglistiger Täuschung aufgehoben werden, da die Verkäuferin den Konflikt mit der Stadt und den tatsächlichen Zustand des Hauses verschwiegen hatte. Das Expose vermittelte den Eindruck einer nahezu neuwertigen Kernsanierung, was nicht der Realität entsprach. Die Elektroinstallation erfüllte nicht den versprochenen Standard, und die Verkäuferin konnte sich nicht auf den Gewährleistungsausschluss berufen, weil sie die Renovierungen selbst durchgeführt und den wahren Zustand des Hauses gekannt hatte.
Hinweis: Ein Gewährleistungsausschluss schützt Verkäufer nicht vor den Folgen der arglistigen Täuschung. Käufer können den Kaufvertrag anfechten und ihr Geld zurückverlangen, wenn der Verkäufer wesentliche Mängel verschwiegen hat. Auch unzulässige bauliche Veränderungen können eine Rückabwicklung rechtfertigen.
Quelle: LG Frankenthal, Urt. v. 01.10.2025 – 6 O 259/24
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 02/2026)
Erworbene Produkte kann man umtauschen, wenn man merkt, dass damit irgendetwas nicht stimmt. Doch wie sieht es mit bereits vermitteltem Wissen aus, wenn dem Anbieter selbst die Zulassung zur Wissensvermittlung gefehlt hat? Kann ein Coachingteilnehmer sein Geld zurückfordern, wenn der Anbieter keine Zulassung nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG) besitzt, das Coaching hingegen bereits in Anspruch genommen hat? Das Amtsgericht Paderborn (AG) hat dazu eine klare Meinung.
Die Teilnehmerin hatte im März 2023 online einen Vertrag über ein achtwöchiges Coachingprogramm abgeschlossen und insgesamt 3.570 EUR in vier Raten bezahlt. Das Programm beinhaltete etwa 100 Stunden Videomaterial, von denen sie über 70 Stunden nutzte, sowie eine Gruppe mit Coaches und anderen Teilnehmern zum Austausch und für Fragen. Die Anbieterin verfügte jedoch nicht über die nach § 12 FernUSG erforderliche Zulassung von Fernlehrgängen. Die Teilnehmerin forderte im September 2023 schließlich die Rückzahlung des vollen Betrags, da der Vertrag wegen fehlender Zulassung nichtig sei, und führte an, dass nur ein Teil des Programms synchron stattgefunden habe und ein Missverhältnis zwischen Leistung und Preis bestanden habe. Die Anbieterin widersprach und argumentierte, das FernUSG gelte nicht, da die Teilnehmerin selbständig tätig sei und der Vertrag keine reine Verbraucherdienstleistung darstelle.
Das AG wies die Klage ab. Das Gericht stellte fest, dass der Vertrag zwar wegen fehlender Zulassung nach § 7 Abs. 1 FernUSG nichtig war, die Anbieterin jedoch Anspruch auf Wertersatz für die bereits erbrachten Leistungen hatte. Die Videos, Livecalls und sonstigen Angebote hatten einen Wert von 3.570 EUR, der den Rückzahlungsanspruch vollständig ausglich. Eine Rückzahlung wurde daher auf null reduziert. Entscheidend war, dass die Teilnehmerin die Inhalte genutzt und davon profitiert hatte.
Hinweis: Ein Vertrag ohne erforderliche FernUSG-Zulassung kann zwar nichtig sein, der Anbieter darf jedoch bereits erbrachte Leistungen in Rechnung stellen. Bereits genutzte Inhalte führen dazu, dass der Rückzahlungsanspruch entfällt. Rückforderungen scheitern regelmäßig an der Saldierung von Leistung und Gegenleistung.
Quelle: AG Paderborn, Urt. v. 05.09.2025 – 57a C 183/24
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 02/2026)