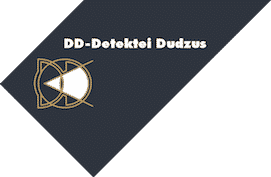Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Mandanteninformationen. Wenn Sie recherchieren oder ältere Ausgaben betrachten möchten, können Sie hier unser Archiv aufrufen.
Zum Thema Sonstiges
- Bei Datenschutzverstößen: BGH urteilt über Klagebefugnis von Verbraucherschutzverbänden
- Bitte setzen! Hitzeschützende Fußmatten gehören nicht zur Verkehrssicherungspflicht von Dampfsaunabetreibern
- Datenverarbeitung ohne Rechtsgrundlage: Meta muss Persönlichkeitsprofile löschen und Schadensersatz zahlen
- Hecken sind Ländersache: In Hessen zählt statt Höhenbegrenzung nur Mindestabstand zum Nachbarn
- Vorbeugung von Missbrauch: Festivalbetreiber darf Rücktauschfrist und Betragsgrenze von Token festsetzen
Im folgenden Fall ging es um einen Verstoß gegen datenschutzrechtliche Informationspflichten der wohl immer noch bekanntesten Social-Media-Plattform. Dagegen geklagt hatte ein Verbraucherschutzverein – und zwar ohne expliziten Auftrag eines von diesem Datenschutzverstoß Betroffenen. Bevor er die Klage inhaltlich und rechtlich bewerten konnte, musste der Bundesgerichtshof (BGH) zuerst einmal klären: Darf der Verbraucherschutzverein das überhaupt?
In dem Fall ging es um das soziale Netzwerk Facebook. Nutzer konnten dort über ein “App-Zentrum” Spiele starten. Vor dem Start erschien ein Hinweis, dass die Spieleanbieter auf viele persönliche Daten zugreifen dürfen – etwa E‑Mail-Adresse, Statusmeldungen oder Fotos. Außerdem hieß es, dass die Anwendung in ihrem Namen posten dürfe. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen fand das nicht in Ordnung und meinte, die Nutzer würden nicht klar genug über die Datenverwendung informiert. Das sei nicht nur ein Verstoß gegen Datenschutzregeln, sondern auch wettbewerbswidrig. Deshalb wollte er Facebook per Klage verbieten lassen, solche Hinweise zu verwenden. Facebook sah das anders und wehrte sich bis vor den BGH.
Der BGH aber gab den Verbraucherschützern Recht: Verbände dürfen klagen, wenn Datenschutzvorgaben verletzt werden – und zwar auch, ohne dass ein Betroffener mitmacht. Es reiche völlig aus, wenn viele Menschen potentiell betroffen sind. Die Richter stimmten zudem der Annahme zu, dass die Hinweise im App-Zentrum unklar und unvollständig waren. Die Nutzer würden nicht verständlich darüber informiert werden, welche Daten wie und warum verarbeitet werden. Genau solche Informationen seien aber wichtig, damit Menschen bewusst entscheiden können, ob sie zustimmen wollen oder nicht. Deshalb dürfen Verbraucherschutzverbände hier einschreiten.
Hinweis: Verbraucherschutzverbände können gegen Datenschutzverstöße auch vorgehen, wenn keine einzelne betroffene Person klagt. Unternehmen müssen Nutzer klar und verständlich über die Datenverarbeitung informieren. Unklare Hinweise verstoßen häufig gegen Datenschutz- und Wettbewerbsrecht.
Quelle: BGH, Urt. v. 27.03.2025 – I ZR 186/17
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 07/2025)
Haben Sie schon längere Zeit in einer Sauna gestanden oder andere dort stehend verweilen sehen? Der folgende Fall des Landgerichts Coburg (LG) macht klar, warum das aller Wahrscheinlichkeit nicht so ist. Die folglich zu klärende Frage war, ob ein Saunabetreiber für Verbrennungen an den Füßen eines Gastes haften muss, der beim Verlassen einer Sauna länger stehenblieb und sich dabei verletzt hatte.
Ein Mann wollte sich in einer Sauna entspannen, die etwa 90 °C Betriebstemperatur aufwies. Beim Hinausgehen blieb der Mann noch ein bis zwei Minuten auf den Kunststoffmatten in der Nähe des heißen Saunaofens stehen, um mit einem Bekannten zu plaudern. Kurz darauf schmerzten seine Füße, und es stellte sich heraus, dass er sich beim abschließenden Schwätzchen Verbrennungen zugezogen hatte, die ärztlich behandelt werden mussten. Der Mann verlangte daraufhin 5.000 EUR Schmerzensgeld vom Betreiber der Saunalandschaft, da er meinte, der Boden sei zu heiß gewesen und die Kunststoffmatten hätten ihn nicht vor der Hitze geschützt.
Das LG wies die Klage jedoch ab. Das Gericht war der Auffassung, dass der Betreiber keine Schuld trägt. Die Temperaturen am Boden seien mit 55 °C bis 60 °C für diese Art Sauna normal. Die Matten seien rutschfest und damit für ihren eigentlichen Zweck geeignet gewesen – Hitzeschutz gehörte nicht dazu. Außerdem sei es unüblich, lange an einer Stelle auf dem heißen Boden zu stehen. Die Sauna sei ein Ort der Ruhe – kein Platz für längere Gespräche. Dass es bei langem Stehen zu Verbrennungen kommen kann, sei jedem klar. Der Betreiber müsse daher auch keine besonderen Schutzmaßnahmen für solche Situationen treffen.
Hinweis: Die Sauna ist kein Treffpunkt für Smalltalk im Stehen, sondern dient der Entspannung. Wer zu lange steht, riskiert Verletzungen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.
Quelle: LG Coburg, Urt. v. 18.11.2024 – 52 O 439/23
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 07/2025)
Der Meta-Konzern und der Datenschutz – eine Kombination, die offensichtlich nie zueinander passen wird. Denn wie heißt es so schön: Wenn du für ein Produkt nichts zahlst, bist womöglich du das Produkt. Das Landgericht Berlin II (LG) hat diesem Denken und vor allem Handeln jedoch einen Riegel vorgeschoben, was personenbezogene Daten angeht, die über sogenannte Meta-Business-Tools gesammelt wurden.
Die Betroffenen hatten geklagt, weil Meta ihre Aktivitäten auf vielen Websites und in Apps mitverfolgt und ausgewertet haben soll. Diese Websites nutzten die sogenannten Meta-Business-Tools, die Daten automatisch an Meta weiterleiten – oft, ohne dass Nutzer davon etwas mitbekommen. So konnte Meta zum Beispiel erfahren, ob jemand eine Apotheke besucht, eine politische Meinung äußert oder ob ein Suchtrisiko bestehe. Die gesammelten Infos wurden laut Gericht genutzt, um Persönlichkeitsprofile zu erstellen, ohne dass die Nutzer das erlaubt hatten. Meta meinte, nicht selbst verantwortlich zu sein, da es die jeweiligen Websitebetreiber seien, die die Tools einsetzen. Außerdem würden persönliche Daten nur genutzt, wenn jemand eingewilligt habe – sonst nur zu Zwecken wie Sicherheit oder Systemschutz.
Das sah das LG jedoch anders und entschied, dass Meta die Daten ohne gültige Einwilligung verarbeitet und damit gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstoßen habe. Deshalb müssen die Daten gelöscht oder anonymisiert werden. Und weil dabei Persönlichkeitsrechte verletzt wurden, bekommt jeder Betroffene 2.000 EUR Schadensersatz.
Hinweis: Noch sind die Urteile nicht rechtskräftig – Meta kann dagegen Berufung einlegen. Wer Onlinedienste nutzt, muss sich jedoch auf den Schutz der eigenen Daten verlassen können. Persönlichkeitsprofile ohne Zustimmung zu erstellen, ist nicht erlaubt. Gerichte schützen hier die Rechte der Nutzer.
Quelle: LG Berlin II, Urt. v. 04.04.2025 – 39 O 56/24
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 07/2025)
Wie hoch eine Hecke sein darf, entscheidet das jeweilige Landesrecht. Um einem Zwist mit Grundstücksnachbarn vorzubeugen, sollte der Zollstock dabei jedoch nicht nur in die Höhe gereckt werden. Denn der Abstand zum jeweiligen Nachbarn ist für eine Hecke, die hoch hinaus will, fast noch wichtiger. Der Bundesgerichtshof (BGH) musste sich nun mit einem hessischen Bambusgewächs und den diesbezüglichen Urteilen der Vorinstanzen beschäftigen.
In dem Fall ging es um zwei Grundstücke in Hessen. Die Beklagte hatte auf einer alten Aufschüttung an der Grenze zu ihrem Nachbarn Bambus gepflanzt. Und dieser tat, was von einem gesund gedeihenden Bambus erwartet wird: Er wuchs tüchtig, so dass bei sechs bis sieben Metern Schluss war mit der Geduld des Grundstücksnachbarn. Dieser verlangte, dass die Pflanzen auf drei Meter zurückgeschnitten werden. Das Landgericht gab ihm noch recht, das Oberlandesgericht (OLG) wies die Klage dann jedoch ab – nun war der BGH gefragt.
Der BGH hob das Urteil auf – aber nicht, weil der Bambus zu hoch war, sondern wegen eines Verfahrensfehlers des OLG. Das war zwar davon ausgegangen, dass der Nachbar den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand von 75 cm zur Grenze eingehalten habe, woran der BGH jedoch so seine Zweifel hegte. Daher muss das OLG nun prüfen, ob der Abstand auch wirklich eingehalten wurde. Denn grundsätzlich gilt: Nur wenn eine Hecke zu nah an der Grenze steht, kann ein Rückschnitt verlangt werden. Eine Maximalhöhe für Hecken gibt es in Hessen dabei nicht, nur eben die Vorschrift, dass Hecken von zwei Metern Höhe den erwähnten Mindestabstand zum Nachbargrundstück einhalten müssen. Wichtig war in diesem Fall, auch zu betonen, dass die zulässige Höhe dabei vom Boden des Grundstücks gemessen wird, auf dem die Hecke steht – auch wenn dieses höher liegt als das Nachbargrundstück, so wie hier durch eine Aufschüttung. Nur wenn das Gelände künstlich aufgeschüttet wurde, um die Pflanzen höher wirken zu lassen, zähle das ursprüngliche Bodenniveau. Im vorliegenden Fall war die Aufschüttung aber schon Jahrzehnte alt. Deshalb ist der Bambus trotz seiner Höhe möglicherweise erlaubt.
Hinweis: Hecken dürfen grundsätzlich so hoch wachsen, wie es das jeweilige Landesrecht erlaubt. Eine feste Höhengrenze – zum Beispiel drei Meter – gibt es nicht automatisch. Wichtig ist vor allem der Abstand zur Grundstücksgrenze.
Quelle: BGH, Urt. v. 28.03.2025 – V ZR 185/23
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 07/2025)
Ein Token – einst der Begriff für einen frühgeschichtlichen Rechenstein – hat sich heute zwar ins Digitale verflüchtigt, dabei aber nicht an Wert verloren. So gelten Bitcoins als Token oder auch Wertmarken auf Festivals – eine praktische Sache für beide Seiten an den dortigen Verkaufstheken. Was aber damit passiert, wenn man zu viel davon gekauft hat und nach der Veranstaltung weder Lust noch Zeit für einen sofortigen Umtausch hat, musste das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) entscheiden.
Bei einem großen Musikfestival durften Besucher nur mit speziellen Token bezahlen, etwa für Essen und Getränke. Diese Token konnte man nur direkt auf dem Festivalgelände kaufen – und auch nur dort wieder zurücktauschen. Die Regeln des Veranstalters sahen vor: Der Rücktausch ist nur während der Öffnungszeiten an den Festivalkassen und nur bis zu einem Höchstwert von 50 EUR möglich. Nach dem Festival oder im nächsten Jahr ist eine Rückgabe nicht mehr erlaubt. Ein Verbraucherschutzverband klagte dagegen. Die Begründung: Gerade am Ende des Festivals sei der Andrang groß. Manche könnten ihre restlichen Token nicht mehr loswerden – zum Beispiel, weil sie schnell zum Zug müssten. Auch die Grenze von 50 EUR sei unfair, da die Besucher vorab nicht wissen könnten, wie viel sie auf dem Gelände brauchen.
Das OLG sah das anders. Es hielt die Regelungen durchaus für rechtens. Die Rücktauschfrist sei zugegeben zwar kurz, deshalb aber nicht automatisch unangemessen. Besucher wüssten schließlich vorher, dass die Token nur auf dem aktuellen Festival gelten. Außerdem sei ein späterer Rücktausch aufwendig – und zwar für beide Seiten. Eine Rückgabe nach dem Festival oder gar erst im nächsten Jahr würde zudem die Gefahr erhöhen, dass gefälschte Token auftauchen. Auch die Grenze von 50 EUR sei verständlich. Laut Veranstalter geben die meisten Besucher sowieso höchstens 35 EUR pro Tag aus. Wer deutlich mehr Token zurückgeben wolle, handle daher eher ungewöhnlich – was ein Hinweis auf Missbrauch sein könne.
Hinweis: Die Entscheidung ist noch nicht endgültig. Der Bundesgerichtshof soll in der nächsten Instanz klären, ob solche Fristen grundsätzlich erlaubt sind.
Quelle: OLG Düsseldorf, Urt. v. 10.04.2025 – I‑20 UKl 9/24
| zum Thema: | Sonstiges |
(aus: Ausgabe 07/2025)