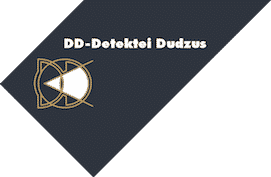Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Mandanteninformationen. Wenn Sie recherchieren oder ältere Ausgaben betrachten möchten, können Sie hier unser Archiv aufrufen.
Zum Thema Arbeitsrecht
- Aufgabenfeld entscheidet: Vier Monate Probezeit können für eine auf zwölf Monate befristete Anstellung angemessen sein
- BAG senkt Hürden: Bereits ein einzelner Gehaltsvergleich kann Ungleichbehandlung vermuten lassen
- EuGH bestimmt Ablauf: Kündigungen sind bei größeren Entlassungsmaßnahmen nur mit richtiger Meldung wirksam
- Ganz oder gar nicht: Arbeitnehmer müssen Sonderzahlungen bei nur teilweisen Tarifverweisen nicht zurückzahlen
- Von “ordentlich” zu “fristlos”: Falsche Angaben in Kündigungsschutzklage können zur sofortigen Kündigung führen
Eine Zusammenarbeit auf Probe kann so lange andauern, wie es das jeweilige Aufgabenfeld oder aber die Position erfordern, um beiderseits sicherzugehen: “Das passt mit uns.” Das Bundesarbeitsgericht (BAG) musste entscheiden, ob die Probezeit bei dem hier befristeten Arbeitsvertrag zu lang angesetzt war. Denn laut Arbeitgeber passte die Angestellte auf Probe eben nicht zum Unternehmen. Ob der Kündigungsschutz nun bereits galt oder eben nicht, war der springende Punkt für die Gekündigte.
Die Angestellte wurde ab dem 22.08.2022 für ein Jahr im Kundenservice angestellt. Beide Seiten legten fest, dass die ersten vier Monate als Probezeit gelten sollten und in dieser Zeit mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden dürfe. Am 10.12.2022 erhielt die Beschäftigte ein Schreiben, in dem das Unternehmen das Arbeitsverhältnis zum 28.12. beenden wollte. Die Betroffene hielt diese Frist für falsch und die Probezeit für zu lang. Sie meinte, auch in ihrem Fall müsse die normale gesetzliche Kündigungsfrist gelten. Außerdem vertrat sie die Ansicht, dass eine unwirksame Probezeitregel die Kündigung während der Befristung insgesamt erschweren könne und daher das Kündigungsschutzgesetz bereits greifen müsse.
Das BAG stellte jedoch klar, dass es keine feste Vorgabe für die Länge einer Probezeit gebe. Entscheidend sei immer, wie lange die Befristung dauere und welche Aufgaben erlernt werden müssten. Im konkreten Fall lag ein Einarbeitungskonzept vor, das drei Lernstufen über insgesamt 16 Wochen vorsah. Da die Probezeit genau diesem Zeitraum entsprach, hielt das Gericht jene vier Monate auch für angemessen. Es erklärte außerdem, dass selbst eine zu lang bemessene Probezeit nichts daran ändern würde, dass die gesetzliche Wartezeit von sechs Monaten für den allgemeinen Kündigungsschutz weiterhin gilt. Die Kündigung musste daher auch nicht besonders begründet werden. Am Ende bestätigte das höchste Gericht in Sachen Arbeitsrecht, dass das Arbeitsverhältnis fristgerecht beendet worden war und die Einwände der Beschäftigten somit nicht griffen.
Hinweis: Wer befristete Verträge nutzt, sollte die Probezeit nachvollziehbar planen. Eine saubere Begründung verhindert Streit über Kündigungsfristen. Doch selbst bei Fehlern in der Probezeitklausel bleibt die gesetzliche Wartezeit unverändert.
Quelle: BAG, Urt. v. 30.10.2025 – 2 AZR 160/24
| zum Thema: | Arbeitsrecht |
(aus: Ausgabe 01/2026)
Die Tatsache, dass hierzulande nur ungern über den Verdienst geredet wird und Arbeitgeber gern versuchen, den entsprechenden Austausch unter Kollegen zu verhindern, macht es schwer, sich gegen eine vermutete Ungleichbehandlung zu wehren. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat nun die Hürden herabgesetzt, die es für eine darauf ausgerichtete Klage zu überwinden gilt. Es stellte mit der kürzlich ergangenen Entscheidung klar, welche Anforderungen es an einen sogenannten Paarvergleich stellt.
In einem Unternehmen forderte eine Beschäftigte rückwirkend mehr Geld, weil sie meinte, für gleiche oder zumindest gleichwertige Aufgaben schlechter bezahlt worden zu sein als ihre männlichen Kollegen. Dabei stützte sie sich auf interne Zahlen aus einem gesonderten Informationsbereich, der Einblicke in Gehaltsstrukturen bot. Diese Daten zeigten auf, dass die ausgewählten Männer über dem mittleren Einkommen ihrer Ebene lagen. Das Unternehmen widersprach und erklärte, die Vergleichspersonen hätten andere Tätigkeiten ausgeübt, so dass ein direkter Vergleich unzulässig sei. Außerdem behauptete der Arbeitgeber, die Beschäftigte habe schwächere Leistungen erbracht, was ihren niedrigeren Lohn erkläre. Das Landesarbeitsgericht (LAG) folgte dieser Sicht weitgehend und meinte, ein einzelner männlicher Kollege reiche allein nicht aus, um eine Vermutung für eine Benachteiligung auszulösen. Wegen der geringen Größe der Vergleichsgruppe und abweichender Medianwerte sah das LAG keinen hinreichenden Hinweis auf eine Ungleichbehandlung, sprach aber für kleinere Vergütungsbestandteile eine Ausgleichszahlung zu.
Das BAG hob diese Entscheidung des LAG auf und betonte, dass keine hohen Hürden für Entgeltgleichheit gelten dürfen. Es reiche aus, wenn eine Frau zeigen könne, dass ein einzelner Mann bei gleicher oder gleichwertiger Tätigkeit mehr erhalte. Die Größe der Gruppen oder unterschiedliche Durchschnittswerte spielten für die Vermutung keine Rolle. Entscheidend sei allein, dass eine konkrete Vergleichsperson existiere, die besser bezahlt werde. Da das LAG falsche Maßstäbe angewandt hatte, müsse es den Fall erneut prüfen und klären, ob der Arbeitgeber den Verdacht durch sachliche Gründe entkräften könne.
Hinweis: Dieses Urteil stärkt Schutz vor Entgeltungleichheit deutlich. Bereits ein einzelner Vergleich genügt, um den Verdacht einer Ungleichbehandlung auszulösen. Unternehmen müssen dann nachvollziehbar erklären, warum derlei Differenzen bestehen.
Quelle: BAG, Urt. v. 23.10.2025 – 8 AZR 300/24
| zum Thema: | Arbeitsrecht |
(aus: Ausgabe 01/2026)
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) befasste sich mit der Frage, wann Kündigungen in größeren Entlassungswellen wirksam werden und welche Folgen eine fehlende oder fehlerhafte Meldung an die zuständige Behörde hat. Dazu legte es dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) den Fall vor. Dieser traf eine Entscheidung, indem er die hierfür notwendigen Abläufe klar festlegte.
Anlass für diese Klärung gab ein Fall vor dem BAG, bei dem ein langjähriger Beschäftigter einer GmbH nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens seinen Arbeitsplatz verloren hatte. Der Insolvenzverwalter hatte das Arbeitsverhältnis bereits am Tag nach der Verfahrenseröffnung gekündigt, nachdem zuvor schon mehrere Kolleginnen und Kollegen die Firma verlassen mussten. Dadurch lag also eine geplante größere Entlassung vor, und eine solche hätte eine vorherige Meldung bei der Arbeitsbehörde nötig gemacht. Da diese Meldung aber fehlte, verlangte der Beschäftigte die Feststellung, dass seine Kündigung unwirksam gewesen sei.
Der EuGH entschied, dass eine Kündigung in solchen Fällen frühestens 30 Tage nach Eingang einer vollständigen und rechtzeitigen Anzeige wirksam werden durfte. Die Frist starte nur dann, wenn alle notwendigen Angaben vorliegen; eine später nachgereichte Meldung beseitigte den ursprünglichen Fehler nicht. Der vorgeschriebene Ablauf besteht demnach aus Beratung der Arbeitnehmervertretung, danach aus der Meldung bei der Behörde und erst dann aus dem Ablauf der Frist. Eine bereits ausgesprochene Kündigung könne nicht im Nachhinein wirksam gemacht werden. Der EuGH stellte zudem in einem anderen Fall klar, dass fehlende Informationen – etwa zu Gesprächen mit der Interessenvertretung – den Zweck der Meldung nicht erfüllen. Auch eine einfache Eingangsbestätigung der Behörde änderte in diesem Fall daran nichts. Selbst eine unvollständige Anzeige setzte die 30-Tage-Frist nicht automatisch in Gang, da die Richtlinie für Verstöße andere Durchsetzungsmöglichkeiten vorsah.
Hinweis: Ohne eine vollständige Meldung kann eine Kündigung im Rahmen größerer Entlassungen nicht wirksam werden. Fehler können nicht nachträglich geheilt werden. Unvollständige Angaben lösen die gesetzliche Frist nicht aus.
Quelle: EuGH, Urt. v. 30.10.2025 – C‑134/24
| zum Thema: | Arbeitsrecht |
(aus: Ausgabe 01/2026)
Ein Arbeitgeber bestand auf die Einhaltung einer Klausel, die der klagende Arbeitgeber einst mit seiner Unterschrift unter dem Arbeitsvertrag abgesegnet hatte und die auf einen Reformtarifvertrag verwies. Problem war nur, dass es sich beim Arbeitgeber um einen nicht tarifgebundenen Betrieb handelte. Ob diese Form der Rosinenpickerei arbeitsrechtlich überhaupt möglich ist, musste final das Bundesarbeitsgericht (BAG) klären.
Ein Rettungssanitäter arbeitete seit 2020 in einem nicht tarifgebundenen Betrieb, dessen Arbeitsvertrag jedoch bestimmte, dass der Reformtarifvertrag des Deutschen Roten Kreuzes gelten sollte. Darin stand, dass eine Sonderzahlung zurückgegeben werden müsse, wenn jemand aus persönlichen Gründen spätestens bis zum 31.03. des Folgejahres ausscheide. Für November 2021 erhielt der Beschäftigte eine Sonderzahlung von 2.767,19 EUR brutto. Am 19.01.2022 kündigte er sein Arbeitsverhältnis zum Ende März, was die Geschäftsführung bestätigte und zugleich ankündigte, den Bonus zurückzufordern. In den folgenden drei Monaten zog das Unternehmen mehrere Teilbeträge vom Nettolohn des Rettungssanitäters ab. Dieser akzeptierte die Abzüge nicht und verlangte die volle Auszahlung seines Gehalts. Er argumentierte, dass er erst am 31.03. ausschied und die Tarifregel deshalb nicht griff. Außerdem hielt er die Klausel für eine unfaire Vertragsgestaltung.
Das BAG entschied, dass der Beschäftigte die Sonderzahlung in der Tat nicht zurückgeben musste, weil dem Unternehmen eine wirksame Grundlage für seine Forderung fehlte. Die tarifliche Regel hielt der rechtlichen Überprüfung nicht stand, da sie Beschäftigte unangemessen benachteiligte und damit unwirksam war. Zwar unterliegen Tarifverträge normalerweise nicht dieser Kontrolle, jedoch galt dies hier nicht, weil der Tarifvertrag nur teilweise in den Arbeitsvertrag übernommen worden war. Das BAG stellte daher klar, dass nur vollständig übernommene Tarifverträge vor einer Inhaltskontrolle geschützt seien. Werden dagegen nur einzelne Teile übernommen, können diese wie gewöhnliche Vertragsklauseln geprüft werden.
Hinweis: Teilweise übernommene Tarifregeln können unwirksam sein. Rückzahlungsforderungen sollten deshalb genau geprüft werden, da Sonderzahlungen nicht automatisch zurückgegeben werden müssen, nur weil der Vertrag das aussagt.
Quelle: BAG, Urt. v. 02.07.2025 – 10 AZR 162/24
| zum Thema: | Arbeitsrecht |
(aus: Ausgabe 01/2026)
Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen (LAG) befasste sich mit einer interessanten Frage: Kann das Fälschen eines Schriftstücks zur fristlosen Kündigung führen, wenn selbst das Original nicht geeignet wäre, den begehrten Anspruch dem Arbeitgeber gegenüber durchzusetzen? Im Gegensatz zu den vorinstanzlichen Kollegen legte es bei der Beantwortung der Frage seinen Schwerpunkt darauf, wie schwer ein solches Verhalten rechtlich wiegt.
Ein E‑Bike-Händler beschäftigte seinen Mitarbeiter seit 2016. Der langjährige Angestellte leitete im Verlauf der langen Zusammenarbeit schließlich auch eine Filiale. Dann stellte das Unternehmen bei zwei Inventuren Ende 2023 erhebliche Fehlbestände fest, von denen ein Teil ungeklärt blieb. Anfang 2024 sollte der Beschäftigte schließlich darlegen, wie diese Lücken entstanden sein könnten. Er wurde zugleich auf mögliche Unregelmäßigkeiten angesprochen und erhielt noch am selben Tag die ordentliche Kündigung. Der Angestellte zog dagegen vor Gericht und verlangte eine Bonuszahlung von 10.000 EUR. Als Beleg für diesen Anspruch legte er ein Dokument vor, das wie ein alter Vertrag wirkte, aber keine Arbeitgeberunterschrift enthielt. Prompt folgte am 21.02.2024 die fristlose Kündigung. Das Arbeitsgericht hielt diese jedoch für ungerechtfertigt, weil es keine Pflichtverletzung erkennen wollte und den eingereichten Vertrag nicht als tauglichen Beleg ansah. Schließlich sei ein von Arbeitgeberseite nicht unterschriebenes Schriftstück gar nicht geeignet, einen Anspruch durchzusetzen.
In der Berufung kam das LAG jedoch zu einem anderen Ergebnis. Nach seiner Bewertung durfte das Arbeitsverhältnis sofort beendet werden, weil das Verhalten des Beschäftigten so schwer wog, dass ein Abwarten der Kündigungsfrist arbeitgeberseitig als unzumutbar erschien. Das Gericht wertete die bewusst falsche Darstellung im Prozess als schweren Verstoß gegen die Pflicht zur Rücksichtnahme. Wer im Verfahren Tatsachen erfindet, um sich Vorteile zu verschaffen, überschreitet aus Sicht des LAG eine klare Grenze. Der eingereichte, nicht unterschriebene Vertrag sollte seiner Einschätzung nach gezielt einen Anspruch vortäuschen.
Hinweis: Unwahre Tatsachenbehauptungen in einem Rechtsstreit können arbeitsrechtlich gravierende Folgen haben. Wer absichtlich falsche Grundlagen schafft, gefährdet nach dieser Entscheidung seinen Arbeitsplatz. Auch im Streit gilt, dass nur echte und überprüfbare Angaben verwendet werden dürfen.
Quelle: LAG Niedersachsen, Urt. v. 13.08.2025 – 2 SLa 735/24
| zum Thema: | Arbeitsrecht |
(aus: Ausgabe 01/2026)